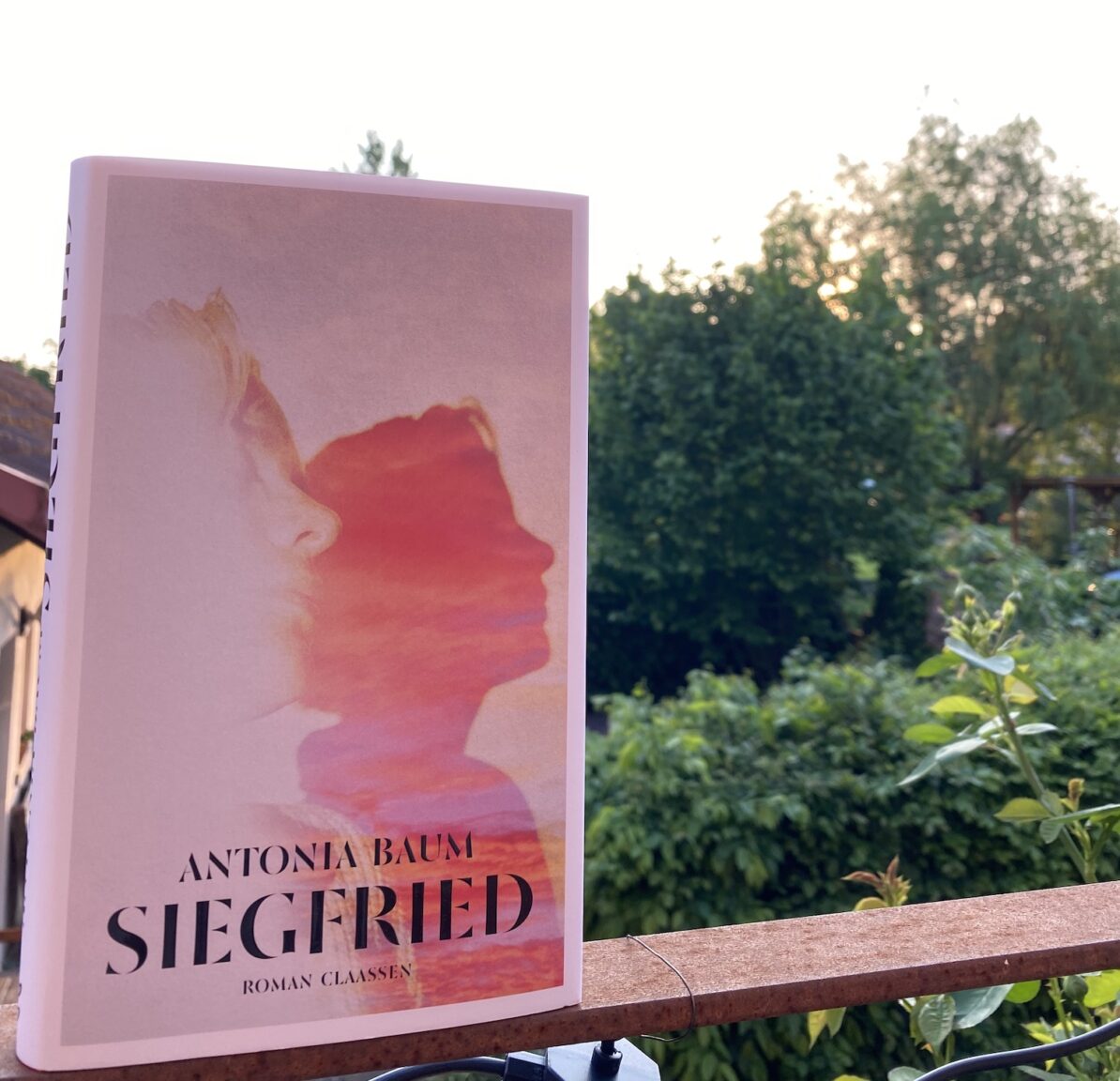Es gibt Autorinnen und Autoren, von denen lese ich eigentlich alles – einfach weil sie so wahnsinnig gut schreiben. Eine davon ist Antonia Baum. Früher hat sie im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben, mittlerweile ist sie im Feuilleton der ZEIT. Ihre Themen drehen sich um die interessanten Themen der Welt, also Rap, Feminismus, Gesellschaft und Familie. Ich freue mich immer, wenn ich ihren Namen über oder unter einem Artikel lese (egal ob über Haftbefehl oder Elena Ferrante) und habe auch alle ihre Bücher gelesen. Außer das über Eminem, weil ich Eminem leider so uninteressant finde, dass ich nichtmal von Antonia Baum etwas über ihn lesen möchte.
Ihr Schreibstil ist einzigartig. Eindeutig Rap-geprägt, schreibt sie sehr umgangssprachlich, eher in einer Sprech-Sprache. Sie schafft es offensichtlich, ihre Redakteur*innen und Lektor*innen davon zu überzeugen, die ganzen Füllwörter, Wendungen, Einschübe drinzulassen, die einem Journalistenschulen und Schreibratgeber eigentlich verboten haben, weil sie angeblich die Leser*innen verwirren. Antonia Baums Sätze sind auch häufig ein bisschen zu lang und zu verworren. Aber ich mag es und bin damit offensichtlich nicht alleine.
„Extrem unwahrscheinliche Situation eigentlich: Ein junger Mann (Jahrgang 1986), dessen kurdischer Vater aus Armut von der Türkei nach Deutschland floh, um hier ein besseres Leben zu führen, sitzt heute (teure Lederjacke, Uhr, Schuhe, alles teuer) an einem Glastisch in der Universal-Chefetage und beantwortet dieser Zeitung Fragen.“
typischer Antonia Baum-Satz aus einem Artikel der FAS über Haftbefehl
„Siegfried“ heißt ihr neues Buch, ihr mittlerweile sechstes. Wenn man ein Überthema suchen will, ist es wahrscheinlich „Mental Load“. Ein Begriff, der in den letzten Jahren ein Kernthema bei der Betrachtung von Familienkonstrukten geworden ist. Es geht darum, dass selbst bei Paaren, die sich vornehmen und ausprobieren, Kindererziehung und Haushalt einigermaßen gleichverteilt zu gestalten, viele der unsichtbaren Dinge trotzdem bei der Frau hängenbleiben. Vor allem Sachen, an die man denken muss: Geschenke für Kindergeburtstage, neue Schuhe in der richtigen Schuhgröße fürs Kind, Aussortieren der zu kleinen Hosen im Kleiderschrank, das leere Waschmittel und so weiter.
Bei der namenlosen Protagonistin in „Siegfried“ kommen auch noch Geldsorgen hinzu, ein abwesender, Bar-jobbender Freund und eine Schreibblockade der Schriftstellerin. Als das alles zusammenkracht, geht sie morgens aus dem Haus und fährt in die Psychiatrie. In der Reflektion darüber, wie sie da eigentlich gelandet ist, geht es in Rückblenden um ihr Familienleben vor ihrer eigenen Familie.
Da ist der patriarchalische Stiefvater (Siegfried), Macher und Versorger, Mann alter Schule und das Gegenteil ihres liebenswerten aber verpeilten Partners Alex.
„Saß Siegfried mir irgendwo gegenüber (es waren meist Restaurants und Hotels), dann lagen sein Telefon (erst Blackberry, später das neuste iPhone), der Wirtschaftsteil (auf Buchformat zusammengefaltet) und manchmal ein oder mehrere Schlüssel (Hotelzimmer, Mietwagen, sein Wagen) vor ihm. Es muss für ihn schwer einzuordnen gewesen sein, dass bei Alex nichts lag.“
Siegfrieds Mutter Hilde, bei der sie bleibt oder bleiben muss, wenn ihre Eltern verreisen. Hilde ist die Nazi-Oma, die sie zur Disziplin beim morgendlichen Schwimmtraining antreibt und Abends mit ihr händchenhaltend die Tagesschau guckt.
Und natürlich ihre eigene Mutter, eine Französin, etwas lebensuntauglich, unsicher im Umgang mit ihrer Tochter, die sich beim Versuch ihr Leben in Ordnung zu halten in einen Putzzwang verfallen ist.
All das erzählt viel davon, wie Familien damals funktionierten und wie der Versuch, es heute anders zu machen, scheitern kann. Wen das interessiert, dem kann ich empfehlen, „Siegfried“ zu lesen.